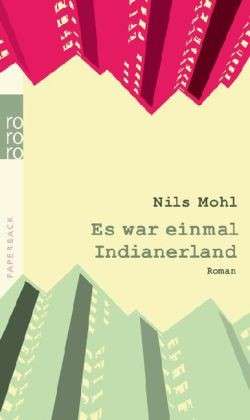
Es war einmal Indianerland. Roman
Reinbek: Rowohlt Taschenbuch 2011
347 Seiten
€ 12,95
Ab 16 Jahren
Junge Erwachsene
Mohl, Nils: Es war einmal Indianerland
Once upon a time in the West
von Nana Wallraff (2011)
„ – Ist so eine Art Roadmovie-Western, handelt von jungen Typen, sage ich.
– Typen so wie wir?
– Schätze schon.
Ein Pfiff der Bewunderung.“
Das Ghetto eines deutschen Großstadtdschungels ist Schauplatz von Nils Mohls neuestem Roman. Der Erzähler: ein 17-jähriger Boxer, der alleine in einer kleinen Hochhauswohnung über die Runden zu kommen versucht. „Raten Sie mal, wie ich mich fühle. Und wenn Sie schon dabei sind, dann geben Sie doch ruhig einen Tipp ab, warum mich dieser Häuptling seit neuestem zu verfolgen scheint“.
Zusammen mit seinem Kumpel Mauser bereitet sich der Protagonist auf die kommende Boxsaison vor, als seine Welt zunehmend aus den Fugen gerät: Nicht nur die auffallend hübsche und ebenso reiche Jackie bringt seine Hormone in Wallung, auch die sympathische und etwas schräge Edda aus der Videothek macht ihm Avancen. Kondor, ein Schlägertyp, fordert zu einem Kampf. Doch alles steht still, als Zöllner, Mausers Vater, seine Frau erwürgt. Zumal ausgerechnet Mauser nach dem Mord die Leiche bei seinem Vater entdeckt, die Polizei verständigt und Zöllner die Flucht ergreift.
„Es war einmal Indianerland“ ist eine Hommage an den Wilden Westen, vor allem aber an „Winnetou“. Überall finden sich die Spuren von Cowboys und Indianern. Der Ich-Erzähler findet den Westen im flirrenden Licht des Großstadt-Sommers wieder, in unzähligen Requisiten (Jackies Mokassins), in Bildern (Zöllners Gesicht: „ein Canyon, betrachtet aus großer Höhe“), in Landschaftsbeschreibungen, in Szenen und Handlungselementen. Die Figuren tragen Namen wie Mauser, Kondor, Zöllner oder Ponyhof und könnten kaum typischer sein – Krieger, „Grünhörner“, Outlaws, Weicheier.
„Es war einmal Indianerland“ durchbricht und erweitert Konventionen, indem die zeitliche Struktur des Geschehens völlig aufgehoben wird. Nicht linear, sondern in einem ständigen Hin und Her offenbart sich die Geschichte. Ein Bezug zum Video ist dabei stets präsent: Als würde er ein Video zeigen, spult der Erzähler mal vor, mal zurück, pausiert stellenweise um Informationen einzuschieben. Entsprechende Symbole unterstützten diesen Eindruck: Play, Pause, Fast-forward, Rewind, Stopp.
Sicher sein kann man sich dabei nie. Ob es der Häuptling ist, der den Ich-Erzähler verfolgt, oder die merkwürdige Beziehung des Protagonisten zu seinem Kumpel Mauser – die durchaus paranoiden Wildwest-Wahrnehmungen des Erzählers bleiben stets unzuverlässig und erinnert an zeitgenössischen Film („Fight Club“ lässt grüßen). Mehr als einmal überschreitet der Protagonist die Grenzen des ‚Normalen’, gleichzeitig scheint dies in der kargen und brutalen Wirklichkeit der Betonschluchten auch mehr als verständlich. Nach außen hin ist er ein Kämpfer, ein harter Typ, dem keiner das Wasser reichen kann und doch ist er ein sensibler Kerl, der über Körpergerüche ins Schwärmen gerät und verzweifelt versucht, einen Sinn im Chaos zu entdecken, seine Identität zu finden – und dabei erwachsen wird.
Der Protagonist muss sich zwischen Jackie und Edda entscheiden. Die hübsche rothaarige Jackie ist zu schön um wahr zu sein, abgebrüht, reich und künstlich. Edda dagegen ist eine Naturgewalt, „gefühlsklug“, groß und ehrlich. Eigentlich ist die Entscheidung klar – doch irgendwie ist nichts so klar, wie es sein sollte. Und so macht er sich schließlich zusammen mit Edda auf den Weg zur Grenze. Sie ziehen westwärts, auf der Suche nach Zöllner, dem Outlaw. Ihr Ziel: ein Festival – das „Powwow“. Dort gelten keine Regeln mehr („wir feiern nicht, wir eskalieren“). Schurken in Gestalt von Sombrero-Trägern müssen bezwungen werden, und schließlich kommt es – natürlich – zum Showdown: Bewaffnet mit einem Akkuschrauber stellt sich der Protagonist seinen Geistern.
Der Autor bedient sich einer bildhaften Sprache voller Vergleiche, die nicht selten auf Karl May verweisen („Tatsächlich herrscht unter meiner Schädeldecke gerade die gleiche Leere wie im Lauf eines abgefeuerten Henrystutzens vor dem Durchladen“) und verwickelt seine Figuren in rasante Dialoge. Vor allem ist es aber die liebevolle Darstellung seines verrückt-sympathischen Protagonisten, die überzeugt.
Es ist tatsächlich auch „eine Art Roadmovie-Western“, den Mohl uns präsentiert, doch ist er keineswegs klassisch. Ironisch, humorvoll und gleichzeitig liebevoll durchdringen die Bezüge zum Western, vor allem aber zum Wildwestroman die ganze Geschichte. „Es war einmal Indianerland“ ist rasant und unkonventionell geschrieben, überschreitet in jeder Hinsicht Grenzen und wird nicht nur die Herzen eingefleischter Wildwest-Fans höher schlagen lassen.
