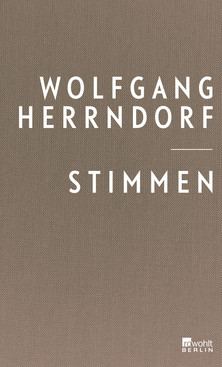
„Texte, die bleiben sollten“
Wolfgang Herrndorfs wirklich allerletztes Buch "Stimmen"
von Thomas Fischer (2020)
Der Maler und Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, dessen Roman Tschick beinahe Weltruhm erlangte, litt an einem Gehirntumor; er starb von eigener Hand im August 2013, als die Folgen der Krankheit unerträglich wurden. Wie einst Franz Kafka bestimmte er, das seine Nachlassmaterialien, mit sehr wenigen Ausnahmen, vernichtet werden sollten – und anders als bei Kafka haben sich Herrndorfs Erben an diese Verfügung gehalten.
Daher umfasst das schmale Oeuvre des Autors neben drei Romanen und einigen Bänden mit Kurzgeschichten nur noch das Fragment Bilder deiner großen Liebe aus dem Nachlass, das eine Fortsetzung zu Tschick werden sollte. Auch das aus einem Weblog hervorgegangene beeindruckende Krankheits-Tagebuch Arbeit und Struktur wurde post mortem noch in gedruckter Form herausgebracht.
Nun haben sich die Herausgeber Marcus Gärtner und Cornelius Reiber entschieden, ein paar Texte, die dem Autodafé entgingen, zu einem weiteren Büchlein zusammenzustellen. Es handelt sich zum größten Teil um Materialien, die Herrndorf im Blog „Wir höflichen Paparazzi“, einer „beinharten stalinistischen Schreibschule“, veröffentlicht hatte und die so bereits den Weg in eine, wenn auch beschränkte, Öffentlichkeit gefunden hatten.
Doch leider muss man einwenden, dass die Beteuerung der Herausgeber, dass sich hier nichts fände, „was nur Dokument oder Autorenreliquie wäre“, nicht eingelöst wird. Die meisten Texte sind skizzenhaft, wirken aus dem Zusammenhang, in dem sie im Blog vermutlich standen, herausgerissen und entfalten nicht die Sogwirkung und den Wiedererkennungseffekt, durch die Herrndorfs beste Werke sich auszeichnen.
Die ersten drei der in fünf Teile gegliederten Sammlung beschäftigen sich mit frühen Liebschaften des Autors, seinem Alltagsleben in Berlin sowie umfangreichen Lektüreerfahrungen – mit zum Teil harschen, aber in ihrer Apodiktik auch durchaus amüsanten (Fehl-)Urteilen: „Heinrich Mann: Schrott. Sartre: Schrott. Böll: totaler Schrott. B. Traven: unlesbar.“ Teil vier ist ein in Thomas Bernhardscher Manier als „Dramolett“ bezeichneter Dialog zwischen Herrndorf und einem bigotten Fernsehmoderator. Das als „Akalkulie“ (Rechenschwäche) bezeichnete, buchstäblich Gott und die Welt behandelnde und mit wüsten Beschimpfungen gespickte Streitgespräch ist mit seinem übersteigerten Pathos sicher ein Produkt der „psychotischen Phase“ des Autors nach der Krebsdiagnose, wie die Herausgeber im Nachwort ausführlich erläutern. Der letzte Teil schließlich versammelt einige Gedichte aus der frühen Schaffensphase des Schriftstellers. Auf diese epigonalen Ergüsse hätte man am ehesten verzichten können.
So bleibt letztlich der fade Nachgeschmack, dass Rowohlt hier noch ein letztes Mal mit dem Namen Wolfgang Herrndorf einen Verkaufserfolg landen will, bevor dessen Werk die gefährliche Flaute zwischen Bestseller und Klassiker, die Arno Schmidt des Öfteren kommentiert hat, erreichen wird. Mit viel Raum zwischen den Abschnitten und einem langen Nachwort wird mit Mühe und Not die Seitenzahl 191 erreicht. Von den hier zusammengestellten Schnipseln verdient lediglich eine längere Passage mit der Schilderung einer ziellosen Autofahrt quer durch Brandenburg Richtung Ostsee besondere Beachtung: Der Ich-Erzähler klaut seinem Freund ein Auto und düst damit deprimiert durch die Lande – wer fühlte sich hier nicht an Tschick erinnert? Ansonsten sollte man sich lieber an Sand oder Arbeit und Struktur halten – mithin Texte, die wirklich bleiben werden.
Leseprobe:
Der alte, verrottete Mann ist braun gebrannt und ledern. Seine Brusthaare wuchern grau nach vorn, er selbst hält sich für stattlich. Im Sommer geht er in den Brunnenpark und setzt sich mit seinem Handtuch zu nah an ein paar junge Mädchen heran, die lässig auf zwei Decken liegen. Ein Wrack treibt vorbei. Das Wrack ist eine fünfundvierzigjährige Frau mit zerstörtem Gesicht, zwei Kilo Schmuck und schwarzer Strumpfhose unter extrem knappem Minirock. Wegen der Hitze trägt sie ihre weiße Lederjacke mit den Nieten überm Arm. Kopfschüttelnd schaut der alte, verrottete Mann ihr hinterher und zeigt auf seinem Gesicht alle Arten von Missbilligung und Ekel, zu denen er fähig ist. Als er einen konsistenten Eindruck von seiner eigenen Mimik hat, wendet er den Kopf den lässigen Mädchen zu, damit sie ihn sehen, aber sie sehen ihn nicht. Er wechselt noch zweimal zwischen missbilligend hier und beifallheischend da und gibt dann auf, ohne erkennbare Zeichen von Niederlage. (S. 79)
