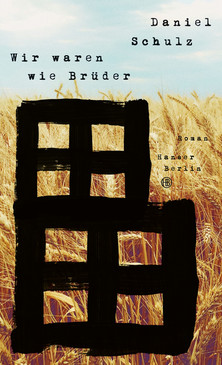
Eine Jugend in Markheide – Zwischen Erinnerungen an die DDR, Neonazis, und Wessi-Scheiß
Von Kathrin Brys, Sarah Erken, Sarah Henselder, Niklas Klein, Jule Neuhaus (2022)
Ein Leben ohne Coca-Cola und Urlaube an Orten wie Spanien oder Italien und stattdessen Jugendorganisationen, wie die Jungpioniere sowie gefürchtete Grenzkontrollen. Während die Erinnerungen an ein geteiltes Deutschland älteren Generationen noch sehr präsent sind, liegen sie für die jüngere Generation in weiter Ferne. Mit „Wir waren wie Brüder” rückt Daniel Schulz eine Zeit in den Fokus, in der sich das Leben unzähliger Menschen von der einen auf die andere Minute ändert und nichts so ist, wie es mal war. Es ist ein Buch über Rechtsextremismus, brutale Gewalterfahrungen und die Suche nach einem Platz in einer Gesellschaft, die sich gerade neu erfinden muss.
Die Thematik entfaltet sich in einer Geschichte über das Erwachsenwerden. Denn zu den Krisen der Adoleszenz, die der Protagonist durchlebt indem er nirgends wirklich Anschluss findet und den Männlichkeitsidealen seiner Zeit nicht zu entsprechen scheint, kommt die Frustration und Instabilität der Nachwendejahre. Aufgrund dessen befindet sich der Protagonist oftmals im Zwiespalt. Während er vor den ‚Glatzen‘ wegrennt, muss er erleben, wie viele seiner Freunde zu Rechtsradikalen werden.
Die einzige Konstante im Leben des Protagonisten scheint Mariam - als erste große Liebe – zu sein. Doch auch die Beziehung der Beiden ist von Konflikten aufgrund ihrer Verschiedenheiten geprägt und kann daher nicht wirklich als Anker in einer von Unsicherheit geprägten Welt dienen. Die relativ kurzen Kapitel und die Zeitsprünge lassen die Leser*innen allerdings vergeblich auf Kontinuität beziehungsweise Verlässlichkeit hoffen und erschweren ein tieferes Eindringen in die durchaus zusammenhängende Geschichte. Dennoch vermittelt dies im Zusammenspiel mit der damaligen Alltagssprache - welche von rassistischen, sexistischen und homophoben Ausdrücken durchzogen ist - ein Gefühl von Authentizität.
Die Erzählung scheint nicht auf ein (für die Leser*innen) befriedigendes Ende hinauszulaufen, gerade dadurch intensiviert „Wir waren wie Brüder“ das Gefühl, sich in das „politische Vakuum der Nachwendezeit“ und die Unsicherheit der „Baseballschlägerjahre“ einzufühlen.
Wie die Triggerwarnung zu Beginn des Romans bereits erahnen lässt, ist er zart besaiteten Leser*innen nicht zu empfehlen. Denn der Roman schockiert. Er stellt die damalige Realität in ihrer Drastik ungeschönt und mit klaren Worten dar. Nur hierdurch kann „Wir waren wie Brüder” in einer Zeit, in der Menschen weiterhin mit rassistischen und demokratiefeindlichen Parteien sympathisieren, Aufklärungsarbeit leisten und eine Antwort auf die Frage geben, ob auf die Instabilität der Nullerjahre ausschließlich Hass auf das Fremde und Rechtsextremismus folgen können.
Bibliographische Angaben:
Schulz, Daniel
Wir waren wie Brüder
Berlin: Hanser Verlag 2022
286 Seiten
Textprobe: „Hat sie verdient, die Polackenfotze”. Uwe dröhnt den Satz heraus wie einer von den Großen. Zu DDR-Zeiten habe ich die Schnatterhexe auch so genannt. Freut mich für Uwe, dass sie wegmuss, aber irgendwie tut sie mir jetzt leid. Die Pflanze hat die Hälfte der Traktoristen entlassen, und die sitzen nur noch hinten an den Garagen und saufen. (S.43)
